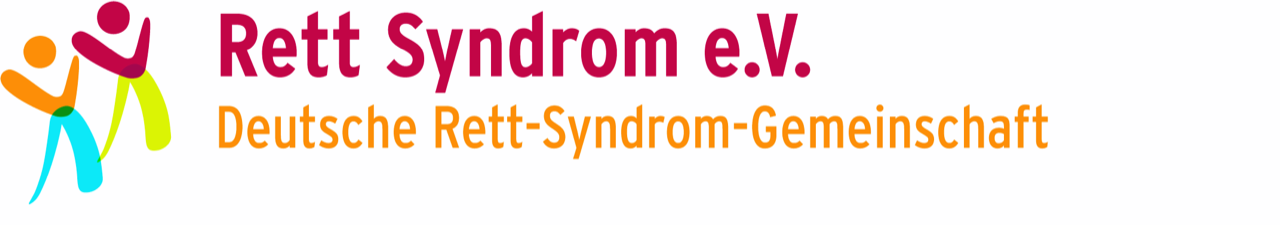Was ist das Rett-Syndrom?

Das Rett Syndrom gehört zu den Erkrankungen des autistischen Spektrums und geht mit schweren körperlichen Behinderungen einher. Die
Erkrankung tritt in der frühen Kindheit unvorhersehbar auf. In den
meisten Fällen sind Mädchen vom Rett Syndrom betroffen. Viele der
betroffenen Mädchen erleben das Erwachsenenalter, sie sind jedoch
zeitlebens auf eine 24-Stunden Betreuung angewiesen. In Deutschland wird
die Prävalenz auf 1:10000 geschätzt. Pro Jahr erkranken in Deutschland
etwa 50 Kinder. Das Rett Syndrom ist nach dem Down Syndrom die
zweithäufigste Behinderung bei Mädchen. Zurzeit leben etwa 2000 bis 3000
Mädchen und Frauen mit Rett Syndrom in Deutschland.
Die charakteristischen waschenden, knetenden Handbewegungen sind zwar sehr typisch, aber nicht spezifisch für das Rett-Syndrom, auch andere Stereotypien können beobachtet werden. Etwa 80-85% der Patientinnen entwickeln eine Epilepsie. Das Rett Syndrom ist auch eine Erkrankung der fortschreitenden Informationsverarbeitung: nicht der „Input“ ist das Problem, sondern der „Output“; täglich kämpfen sie gegen ihren eigenen Körper. Die Unterstützte Kommunikation kann den Mädchen und Frauen dabei helfen, ihre Kommunikation zu fördern und den Output zu verbessern.
Ein Teil der Patientinnen erlernt nie das freie Laufen. Die Pubertät setzt früh ein, meist nicht begleitet von dem physiologischen Wachstumsschub. Die meisten Mädchen mit Rett-Syndrom sind kleinwüchsig, einhergehend mit einer Akromikrie der Füße.
Mit zunehmenden Alter treten vermehrt Bewegungsstörungen und autonome Störungen wie Schreiattacken und ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus auf.
Häufig besteht ein gastroösophaealer Reflux. Wegen Schluckstörungen mit erhöhter Aspirationsgefahr ist zur Sicherstellung einer ausreichenden kalorischen Ernährung die Anlage einer PEG-Sonde oft notwendig.
Die Lebenserwartung ist beim Rett-Syndrom nicht regelhaft verkürzt.
Zum ersten Mal beschrieben wurde das Rett Syndrom 1966 von dem Wiener Arzt Andreas Rett (1924-1997). Der Wiener Kinderneurologe Andreas Rett entdeckte 1965 die typischen Handbewegungen (waschende, wringende Bewegungen) als zwei junge Mädchen im Wartesaal seiner Praxis auf dem Schoß ihrer Mütter saßen und diese die Hände ihrer Töchter zufällig gleichzeitig losließen. Diese Handstereotypien gelten heute als das typische Kriterium für das Rett Syndrom.

Die Hauptkriterien für das Rett Syndrom sind:

- Der normalen Entwicklung des Kindes folgt zwischen dem 6. und 18. Lebensmonat zuerst ein Stillstand und dann eine deutliche Regression. Die erworbenen Fähigkeiten werden wieder verlernt, der normale Gebrauch der Hände geht verloren
- Autistische Züge treten auf, dass bedeutet die Möglichkeit einer emotionalen Kontaktaufnahme und Bindung z.B. zu den Eltern ist sehr eingeschränkt
- Die sprachliche Entwicklung tritt in den meisten Fällen verzögert auf oder bleibt in einem frühen Stadion stecken. Oft entwickelt sich keine Lautsprache, teilweise können die Mädchen einzelne Worte sprechen
- Stereotypien der Hände: waschende Bewegungen in Brusthöhe oder im Bereich des Mundes. Rhythmische Bewegungen des Oberkörpers
- Normaler Kopfumfang bei der Geburt. Eine Verlangsamung des Schädelwachstums kann zwischen dem 5. Lebensmonat und dem 4. Lebensjahr auftreten
- Wenn die Mädchen überhaupt laufen lernen, dann meist nur mit fremder Hilfe. Der Gang ist breitbeinig und sehr unsicher
- Je nach Ausprägung hochgradige kognitive Behinderung (Anm.: Nur da die Verfahrensweise Intelligenz zu messen bei Rett Mädchen nicht einsetzbar ist, heißt dies noch lange nicht das keine Intelligenz vorhanden ist)
Diese und weitere Symptome machen ein selbstständiges und unabhängiges Leben unmöglich.
Symptome und Beschwerden

- Epileptische Anfälle (treten meist zwischen dem 18. Lebensmonat und dem 4. Lebensjahr auf)
- Unregelmäßigkeiten der Atmung
- Zähneknirschen
- schwere Verdauungsprobleme
- Erkrankungen des Skeletts, wie z.B. Skoliose ( Fehlstellung der Wirbelsäule) und Osteoporose ( Knochenschwund)
- Schlafstörungen
- Extreme Angststörungen
- Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems
- Parkinsonsches Zittern
- verzögertes Wachstum
- erhöhter Muskeltonus ( Muskelhypertonie) vor allem bei älteren Menschen mit Rett Syndrom
Krankheitsstadien
1. Stadium: 6. – 18. Lebensmonat
Es kommt zu einer Verlangsamung oder ein Stillstand der motorischen Entwicklung. Aufmerksamkeit und Aktivität nehmen ab. Es zeichnet sich ein scheinbares Desinteresse an Spielsachen, Umgebung und Personen ab.
2. Stadium: 1. – 3. Lebensjahr
Dies ist die Phase der Regression der allgemeinen Entwicklung. Bereits erworbene Fähigkeiten gehen verloren, wie zum Beispiel der funktionelle Gebrauch der Hände und die bereits erworbene Lautsprache. In dieser Phase wird auch oft die Fehldiagnose des Frühkindlichen Autismus gestellt. Die betroffenen Kinder sind sozial und emotional in sich zurückgezogen. Zusätzlich treten plötzliche Schrei und Lachattacken auf.
3. Stadium: 2. – 10. Lebensjahr
Nach einem plötzlichen und raschen Einsetzen der Regression kommen die Rett Mädchen nun in eine ruhigere Phase. Die autistischen Züge vermindern sich und sie beginnen sich wieder für Ihre Umwelt zu interessieren. Die Kommunikationsfähigkeit auf verschiedene Art und Weise verbessert sich. Allerdings verstärkt sich die Apraxie und Ataxie, die Handstereotypien nehmen zu und die ersten Krampfanfälle treten auf. Das unsichere Gangbild wird jetzt deutlich und Skoliose tritt auf bzw. verschlechtert sich.
4. Stadium: ab dem 10. Lebensjahr
Das Kontaktverhalten nimmt weiter zu und es zeigen sich kognitive Fortschritte. Die Krampfanfälle werden weniger oder sind so gut eingestellt, dass sie nicht mehr so häufig auftreten. Allerdings verschlechtert sich die Grobmotorik und Skoliose und Spastizität führen zur Immobilität der Mädchen.